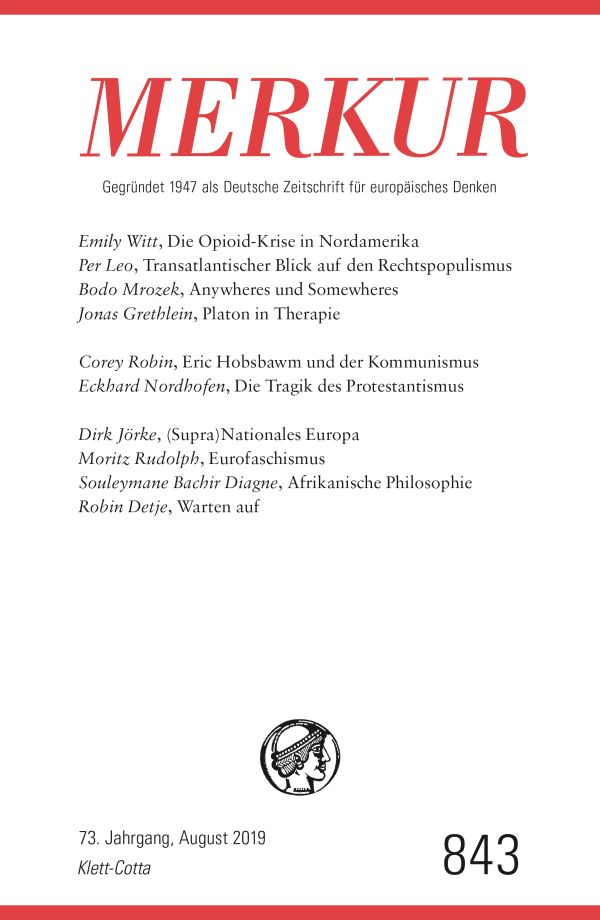MERKUR 8/2019
Nr. 843, Heft 8 / August 2019
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Christian Demand(Hrsg.)
Christian Demand, Jg. 1960, hat Philosophie und Politikwissenschaft studiert und die Deutsche Journalistenschule absolviert. Er war als Musiker und...
Christian Demand, Jg. 1960, hat Philosophie und Politikwissenschaft studiert und die Deutsche Journalistenschule absolviert. Er war als Musiker und Komponist tätig, später als Hörfunkjournalist beim Bayerischen Rundfunk. Nach Promotion und Habilitation in Philosophie unterrichtete er als Gastprofessor für philosophische Ästhetik an der Universität für angewandte Kunst Wien. 2006 wurde er auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg berufen, wo er bis 201...
Inhaltsverzeichnis
ESSAY
EMILY WITT
Groß, weiß und stark.
Über die Opioid-Krise in Nordamerika
PER LEO
Der Nate-Silver-Schock.
Ein transatlantischer Spiegelblick auf den Rechtspopulismus
BODO MROZEK
Von Anywheres und Somewheres.
Das "Heimatbedürfnis der einfachen Menschen" ist ein ahistorisches Konstrukt
JONAS GRETHLEIN
Platon in Therapie
KRITIK
COREY ROBIN
Eric Hobsbawm: Ein Kommunist erklärt die Geschichte
ECKHARD NORDHOFEN
Die Tragik des Protestantismus
MARGINALIEN
DIRK JÖRKE
(Supra)Nationales Europa
MORITZ RUDOLPH
Eurofaschismus – wer gegen ihn ist, könnte für ihn sein
SOULEYMANE BACHIR DIAGNE
Afrikanische Philosophie und die Sprachen Afrikas
ROBIN DETJE
Warten auf
Hefte der gleichen Zeitschrift
Alle Hefte der ZeitschriftDas könnte Sie auch interessieren:

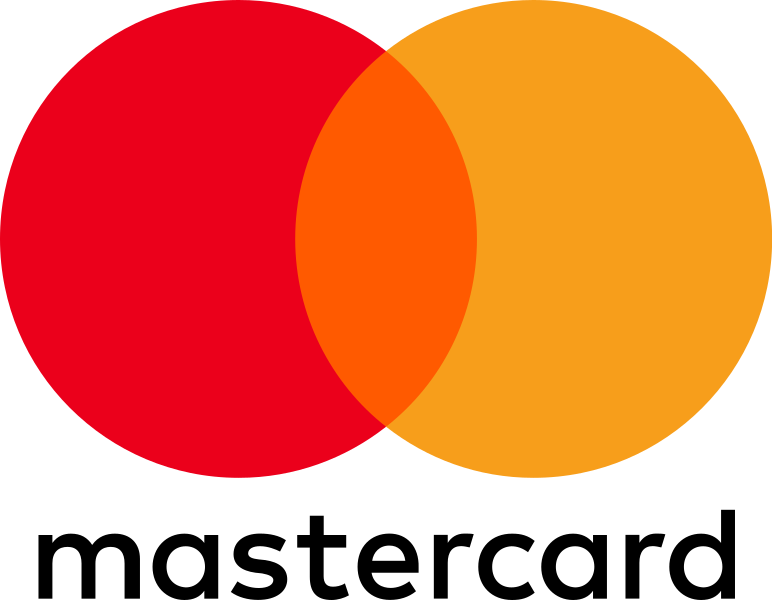

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt