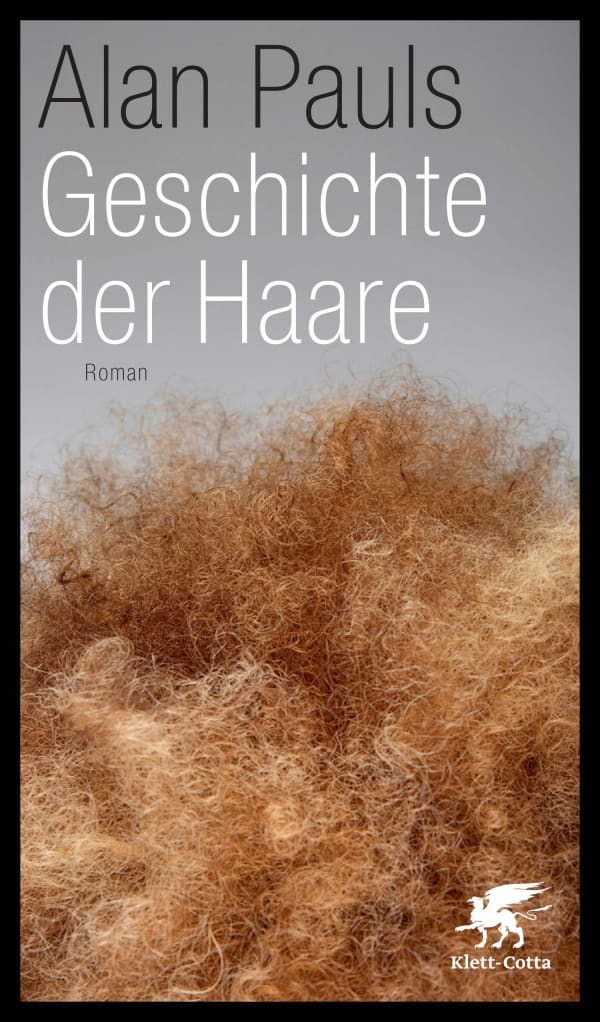Geschichte der Haare
Roman
Beschreibung
»Es vergeht kein Tag, an dem er nicht an seine Haare denkt.«
Ob kurz, lang oder rasiert, ob ungekämmt, gegelt, mit Seiten oder Mittelscheitel oder als Afrolook - in der Suche nach dem perfekten Haarschnitt scheint sich die Sehnsucht des Erzählers nach einem geordneten Leben zu spiegeln.
Aber jedes Mal, wenn die Frisur sich auswächst, droht wieder alles aus den Fugen zu geraten. Bis Celso auftaucht, ein genialischer und zugleich kleptomanischer Friseur, der durch seine Frisierkunst verspricht, den Traum von der ewigen Jugend Wirklichkeit werden zu lassen. Die Utopie eines ewig unveränderlichen Haars ist jedoch die Perücke, und eine solche führt uns geradewegs in eines der finstersten Kapitel der argentinischen Geschichte.
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Alan Pauls
Alan Pauls, geboren 1959 in Buenos Aires, hat Literatur gelehrt, daneben Drehbücher, Filmkritiken, Essays und sechs Romane geschrieben. Er arbeitet...
Alan Pauls, geboren 1959 in Buenos Aires, hat Literatur gelehrt, daneben Drehbücher, Filmkritiken, Essays und sechs Romane geschrieben. Er arbeitet als Kulturkolumnist für eine große Tageszeitung und moderiert eine Fernsehsendung. Sein Werk ist bisher in 14 Sprachen übersetzt worden.
Christian HansenÜbersetzung
Das könnte Sie auch interessieren:

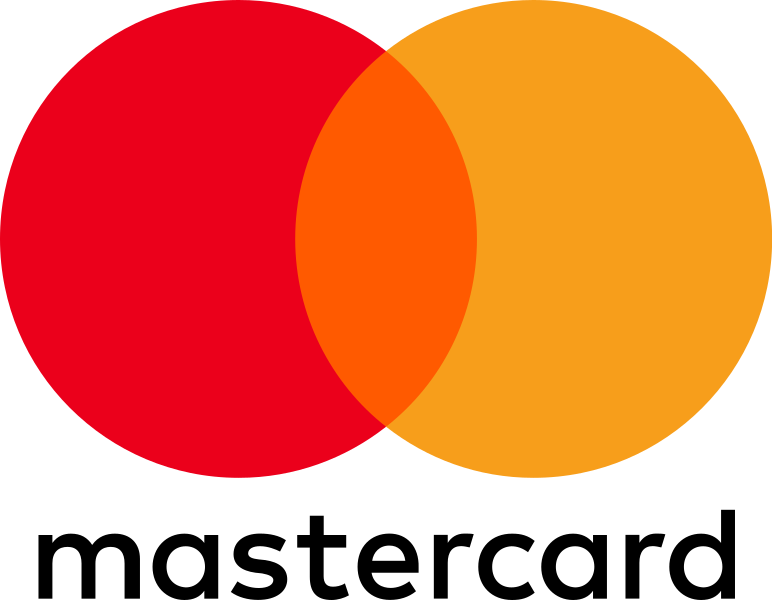

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt