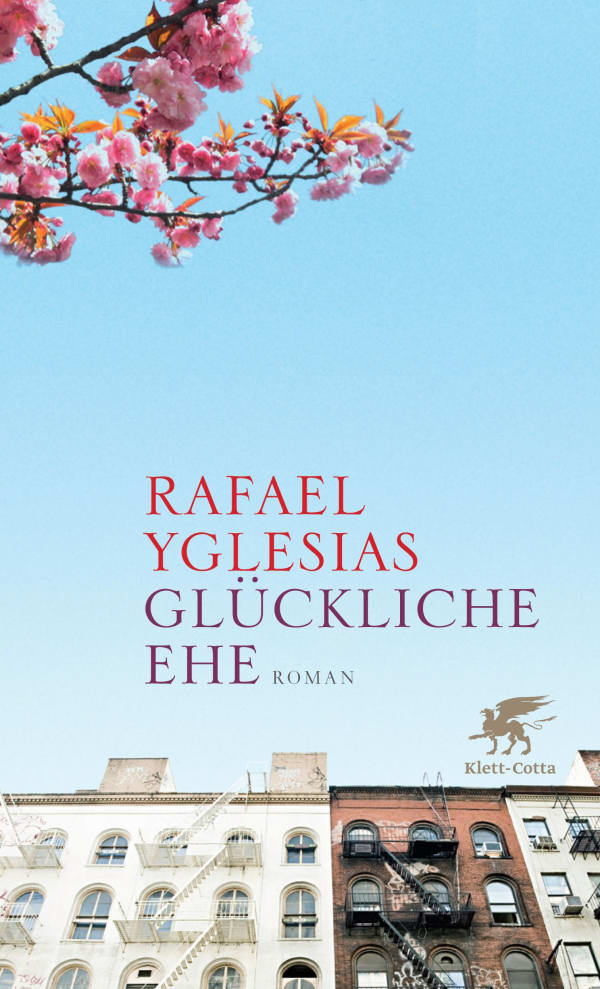Glückliche Ehe
Roman
Beschreibung
Eine ergreifende Geschichte über Anfang, Werden und Abschied einer großen Liebe
»Glückliche Ehe« ist die Geschichte einer fast dreißigjährigen Ehe, von ihren beschwingten Anfängen bis zu ihrem durch Krebs erzwungenen Ende. Die Leichtigkeit und Komik des Kennenlernens in den ersten Wochen wechselt dabei ab mit den bitteren, aber auch erfüllten letzten Monaten von Margarets Leben, als sie sich von Familie und Freunden verabschiedet - und von ihrem Mann Enrique.
»Ich bin froh, dass mir dieses Buch nicht entgangen ist.«
Antje Deistler, WDR2, 23.5.10
Als der 21-jährige Enrique Sabas im wildromantischen Manhattan der Siebzigerjahre auf die drei Jahre ältere Margaret Cohen trifft, weiß er, dass sie die Liebe seines Lebens ist. Doch die familiären Gegensätze könnten größer nicht sein: Er ist ein literarisches Wunderkind, ein eigenbrötlerischer Schulabbrecher, der sich ganz dem Leben der Boheme hingibt, wohingegen die lebhafte, attraktive Margaret aus einem bürgerlichen Haushalt kommt und die kontrollierte Emotionalität ihrer Mutter geerbt hat.
Die erotischen Abenteuer und Missgeschicke in den ersten Wochen ihres Kennenlernens sind verwoben mit Szenen ihrer Ehe - die Erziehung der Kinder, der Verlust eines Elternteils, die Versuchungen eines allzu leichten Seitensprungs -, bevor Margaret mit Mitte fünfzig ihrer Krebserkrankung erliegt. Eine wahrhaftige Geschichte über ein gemeinsames Leben - und darüber, was eine glückliche Ehe ausmacht.
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Rafael Yglesias
Rafael Yglesias, geboren 1954 in New York City, ist der Sohn des Schriftstellerpaars Jose und Helen Yglesias. Mit 17 Jahren brach er die High Schoo...
Rafael Yglesias, geboren 1954 in New York City, ist der Sohn des Schriftstellerpaars Jose und Helen Yglesias. Mit 17 Jahren brach er die High School ab, um seinen ersten Roman zu veröffentlichen, sieben weitere folgten. Als Drehbuchautor schrieb er u. a. »Der Tod und das Mädchen«, »Les Miserables«, »From Hell« und »Dark Water«. Von 1977 bis zu ihrem Tod 2004 war er mit Margaret Joskow verheiratet. »Glückliche Ehe« ist sein erster Roman seit 13 Jahren. Yglesias hat zwei erwachsene Söhne und le...
Cornelia Holfelder-von der TannÜbersetzung

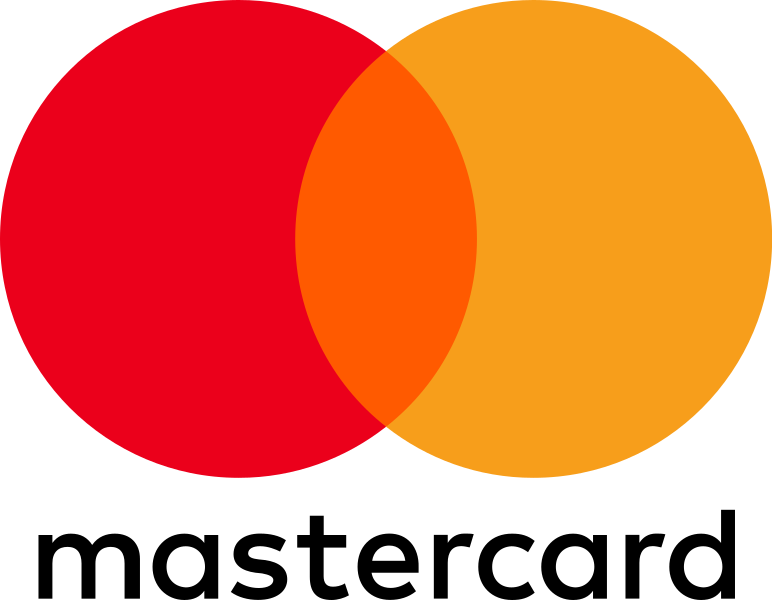

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt