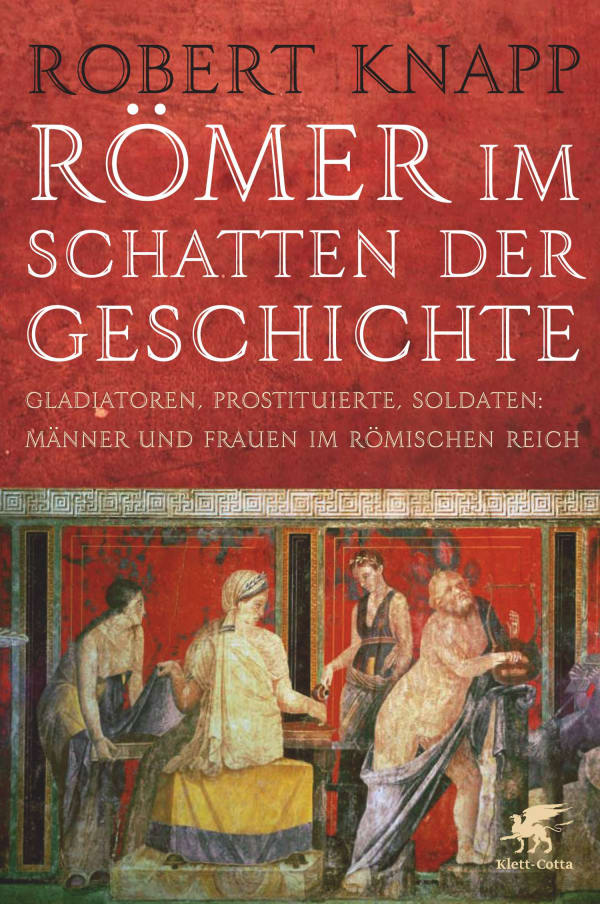Römer im Schatten der Geschichte
Gladiatoren, Prostituierte, Soldaten: Männer und Frauen im Römischen Reich
Beschreibung
»Knapps bemerkenswertes Buch räumt gründlich mit einer Reihe von gängigen Klischees auf und argumentiert überzeugend gegen ein ideales Bild der römischen Gesellschaft.« Michael Opitz, Deutschlandradio
Robert Knapp holt römische »Durchschnittsbürger« und Menschen vom unteren Rand der Gesellschaft aus dem Schatten der Geschichte. In seinem meisterhaft erzählten Buch revidiert er dabei zahlreiche Urteile, die die Geschichtsschreibung bis heute etwa von Cicero oder Tacitus übernommen hat.
Das Bild, das die römische Elite von ihrer Gesellschaft zeichnete und das die Geschichte bis heute fortschreibt, hatte mit der Wirklichkeit der meisten Einwohner des Römischen Reiches sehr wenig zu tun. Denn die Quellen für dieses Geschichtsbild entstammen sämtlich der Oberschicht, die nur 0,5 Prozent der Gesamtbevölkerung im Römischen Reich ausmachte, aber etwa 80 Prozent des Vermögens besaß. Die restlichen 99,5 Prozent - um Christi Geburt geschätzt etwa 50 bis 60 Millionen Einwohner - sind von der Geschichte vergessen. In neun Kapiteln zeichnet der Autor ein Bild vom Leben, Arbeiten und Sterben dieser Männer und Frauen: Arme Bürger und einfache Leute, Sklaven, Freigelassene und Soldaten, Prostituierte, Gladiatoren, Banditen und Piraten.
»Eine vergnügliche und höchst er kenntnisreiche Lektüre«
Geschichte & Wissen
»Knapp bringt komplexe Befunde auf den Begriff, bürstet Gängiges gegen den Strich und führt zugleich eine Fülle anschaulicher, teils wenig bekannter Quellenzitate an. Ein vorzügliches Buch!«
Prof. Dr. Uwe Walter, Damals
»Knapp beklagt die ›Blindheit‹ der Elite für diese Menschen, welche letztlich dazu führte, dass man Rom bis heute vor allem aus dem Blickwinkel dieser Elite wahrnimmt.«
P.M. History
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Robert Knapp
Robert Knapp ist emeritierter Professor für Alte Geschichte in Berkeley, University of California. Er hat sich vor der Erforschung der Mittel- und ...
Robert Knapp ist emeritierter Professor für Alte Geschichte in Berkeley, University of California. Er hat sich vor der Erforschung der Mittel- und Unterschichten insbesondere der Epigraphik und der römischen Geschichte der Iberischen Halbinsel gewidmet.
Ute SpenglerÜbersetzung
Presse-Stimmen
Inhaltsverzeichnis
Einführung: Der Blick in den
Schatten 7
1 In der Mitte: Gewöhnliche Männer
11
2 Ein eigenes Leben: Gewöhnliche
Frauen 65
3 Kampf ums Überleben: Die Armen 113
4 Ein Dasein in
Knechtschaft:Sklaven 143
5 Nach der Sklaverei:Freigelassene
193
6 Ein Leben in Waffen:Soldaten 221
7 Käufliche
Liebe:Prostituierte 266
8 Ruhm und Tod:Gladiatoren 298
9
Jenseits des Gesetzes: Banditen und Piraten 326
Ausklang 354
Anhang
Nachbemerkung zu den Quellen
356
Glossar zu den antiken Autoren und Quellengattungen 365
Dank
371
Quellen- und Literaturverzeichnis 372
Auswahlbibliographie
378
Bildnachweis 387
Register 390
Das könnte Sie auch interessieren:

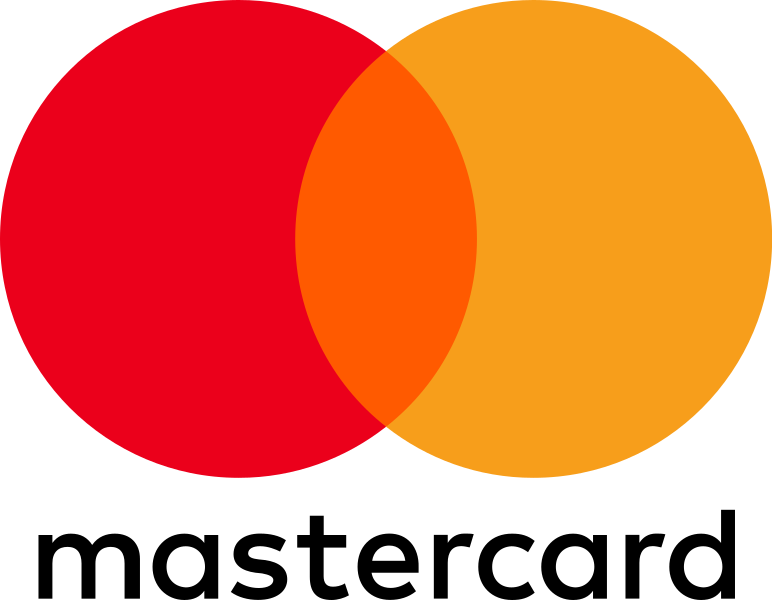

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt