Basales Verstehen
Handlungsdialoge in Psychotherapie und Psychoanalyse
Beschreibung
Psychoanalytische Therapie ist mehr als Austausch von Worten und Gedanken. Basal, unmittelbar wirksam und nachhaltig sind »nicht-sprachliche« Mitteilungen.
Entgegen der These Freuds, es ginge zwischen Analytiker und Analysand »nichts anderes vor, als daß sie miteinander reden«, herrscht heute Konsens darüber, daß die psychoanalytische Therapie mehr ist als eine bloße »Redekur«. Als anerkanntes Wirkprinzip gilt neben der Deutung auch die Beziehung. Günter Heisterkamp entfaltet in diesem Buch theoretisch und an zahlreichen Praxisbeispielen den vielleicht wichtigsten Wirkfaktor, der bisher kaum Beachtung gefunden hat: Die nicht-sprachliche Interaktion zwischen Therapeut und Patient, die sowohl die Kommunikationsformen von Mimik, Gestik und Stimmklang umfaßt als auch atmosphärische Aspekte in der psychotherapeutischen Situation.
Fragt man Patienten danach, was ihnen in ihrer Therapie am meisten geholfen habe, so ist nicht selten zu hören: an einzelne Deutungen könnten sie sich nicht erinnern, wohl aber an den Stimmklang des Therapeuten in einer bedeutenden Situation, an den ermunternden Händedruck, an den zuversichtlichen Blick beim Abschied. Diese »nicht-sprachlichen« Wirkfaktoren zu beschreiben gleicht der Quadratur des Kreises, gleichwohl glückt dieser Versuch - nicht zuletzt dank der vielen aussagekräftigen Fallbeispiele.
Als einer der bekanntesten »Körpertherapeuten« verfügt der Autor über eine außergewöhnliche Sensibilität hinsichtlich der nicht-sprachlichen Beziehungsaspekte zwischen Patient und Therapeut und ist geradezu dazu prädestiniert, die operative, d.h. die unmittelbar wirksame Fundierung einer zeitgemäßen Psychoanalyse zu formulieren.
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Günter Heisterkamp
Prof. Dr. phil. Günter Heisterkamp ist Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker, em. Professor an der Universität Essen; Lehranalytiker am A.-Adler-I...
Prof. Dr. phil. Günter Heisterkamp ist Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker, em. Professor an der Universität Essen; Lehranalytiker am A.-Adler-Institut, Düsseldorf.
Das könnte Sie auch interessieren:

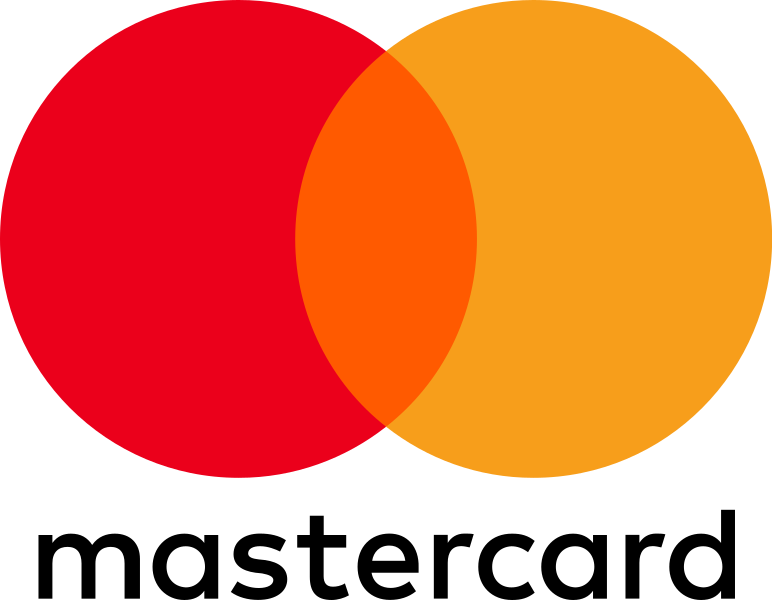

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt



