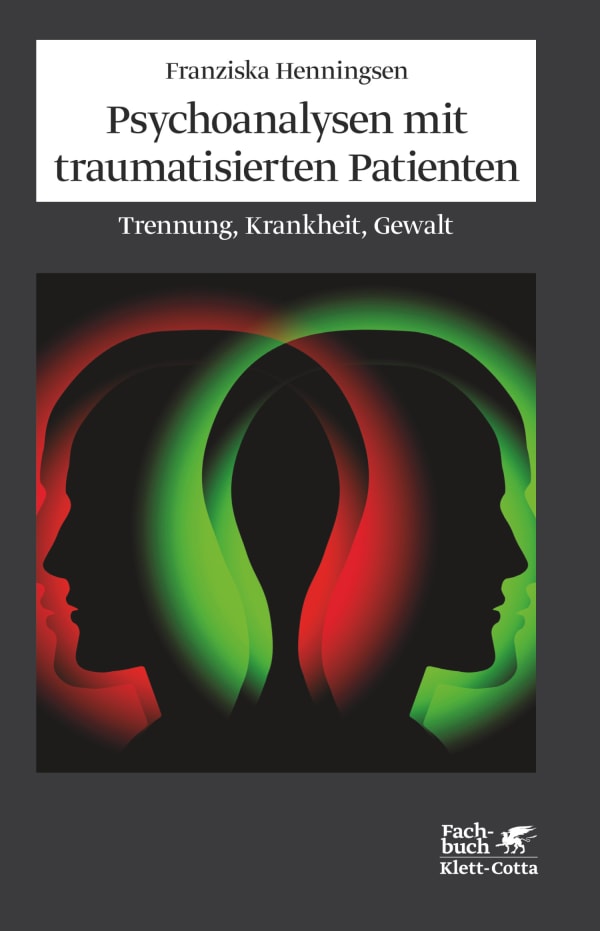Psychoanalysen mit traumatisierten Patienten
Trennung, Krankheit, Gewalt
Beschreibung
Grundsätzliche Empfehlungen für die Praxis
Franziska Henningsen schildert, wie sie als Psychoanalytikerin mit traumatisierten Patienten arbeitet und welche generellen Lehren und Erfahrungen sie ihren KollegInnen mitgeben kann. Der Leser erhält detaillierte Einblicke in das Geschehen im Behandlungszimmer bei der Therapie von traumatisierten Erwachsenen und Kindern und Jugendlichen.
Gravierende traumatische Erfahrungen in der frühen und späteren Kindheit können bleibende Spaltungsstrukturen hervorrufen und Spuren im prozeduralen Gedächtnis hinterlassen, wenn keine restituierende Beruhigung erfolgt. Diesen Patienten kann mit einer Psychoanalyse geholfen werden, vorausgesetzt, die psychoanalytische Technik wird auf die für das Trauma spezifische Beziehungsaufnahme eingestellt. Häufig werden dabei transgenerationelle Prozesse aufgedeckt. Das psychoanalytische Arbeiten mit traumatisierten Patienten unterscheidet sich nicht nur von den Ansätzen anderer psychotherapeutischer Richtungen sondern auch von der sonstigen psychoanalytischen Vorgehensweise, wenn es darum geht, das Unvorstellbare seelische Realität werden zu lassen, damit es verstanden werden kann. Erwachsene, die an einer PTBS leiden, benötigen dagegen eine modifizierte psychoanalytische Behandlung oder eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie.
Die Autorin zeigt dies beispielhaft anhand klinischer Fälle von:
- traumatisch erlebten Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen (z.B. Essstörungen, Leukämie, Depression der Mutter)
- Trennungstraumata (Tod der Mutter im Kleinkindalter, Suizid eines Elternteils, Abwesenheit des Vaters durch Krieg, Wochenkrippe ab der sechsten Lebenswoche)
- Gewalterfahrungen in der Kindheit (häusliche Gewalt, Kriegserlebnisse) und
- Gewalterfahrungen Erwachsener durch Krieg, Folter und Vertreibung (Patienten aus Ex-Jugoslawien, Bundeswehrsoldaten)
Das Buch enthält reichhaltiges klinisches Fallmaterial und Begutachtungen.
Das Buch richtet sich an:
- TraumatherapeutInnen
- PsychoanalytikerInnen
- Kinder- und Jugendlichentherapeuten
- Alle, die sich mit Flüchtlingen und Migranten beschäftigen
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Franziska Henningsen
Franziska Henningsen, Dr. phil., Dipl.-Psych., arbeitete als Psychoanalytikerin in eigener Praxis. Sie war Lehranalytikerin am Karl-Abraham-Institu...
Franziska Henningsen, Dr. phil., Dipl.-Psych., arbeitete als Psychoanalytikerin in eigener Praxis. Sie war Lehranalytikerin am Karl-Abraham-Institut, Berlin und Mitglied der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV), deren wissenschaftliche Sekretärin sie von 2000 – 2004 gewesen war. Sie war Mitbegründerin der Arbeitsgruppe SBPM, die Standards zur Begutachtung traumatisierter Flüchtlinge formuliert und ein Fortbildungscurriculum entwickelt hat.
Franziska Henningsen ist im Februar 20...
Inhaltsverzeichnis
Dank 7
Einleitung: Vom »Einriss im Ich« 9
KAPITEL 1
KRANKE KINDER – KRANKE MÜTTER15
»Heute gibt’s aber keine kranken Kinder bei mir.« –
Todesängste bei Kindern (Marion, Monika und Antje) 17
»Aber das ist das Trauma meiner Mutter, nicht meines.« –
Konkretistische Fusion, Agieren und Symbolisieren (Frau R., Herr V.) 35
»Bis jetzt sind wir noch nicht verhungert.« –
Verstummen im Rückzug und Sprechen in Bildern (Hanna) 55
Spaltung und Fusion 77
KAPITEL 2
TRENNUNGSTRAUMATA 89
»Das ist meine Tochter. Passen Sie gut auf sie auf!« –
Von objektloser Angst zu Trennungsangst (Frau S.) 91
»Alle kennen meine Mutter, nur ich nicht.« –
Konkretistische Fusion und Verleugnung des Objektverlusts (Frau F.) 107
»Die größte Gefahr geht von mir selber aus.« –
Destruktion und Schuld (Herr G.) 119
Agieren und Wiederholungszwang 143
KAPITEL 3
GEWALTERFAHRUNGEN IN DER KINDHEIT 151
Eine Helferin sucht Hilfe. –
Spaltung und seelische Realität (Frau A.) 153
»In diese Hölle will ich nicht.« –
Eine Entwicklung zur Perversion (Herr E.) 169
»Ich verteidige mich selbst.« –
Destruktion und Trost in einem Objekt? (Frau O.) 187
Liebe und Hass 205
KAPITEL 4
GEWALTERFAHRUNGEN DURCH FOLTER UND KRIEG IM ERWACHSENENALTER 215
PTBS: Spaltungsprozesse in der Übertragung 217
Negative Gegenübertragung: Entleerung und Resilienz
(Frau W., Frau B., Frau C., Herr D.) 229
SCHLUSS 245
Konsequenzen für die psychoanalytische Technik 247
Das Trauma in Gesellschaft und Politik. Ein Ausblick 261
Literatur 271
Das könnte Sie auch interessieren:

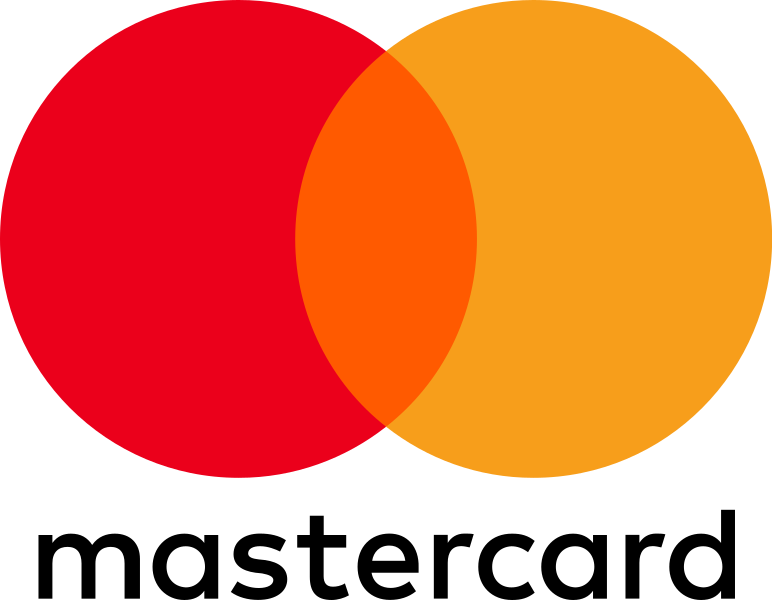

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt