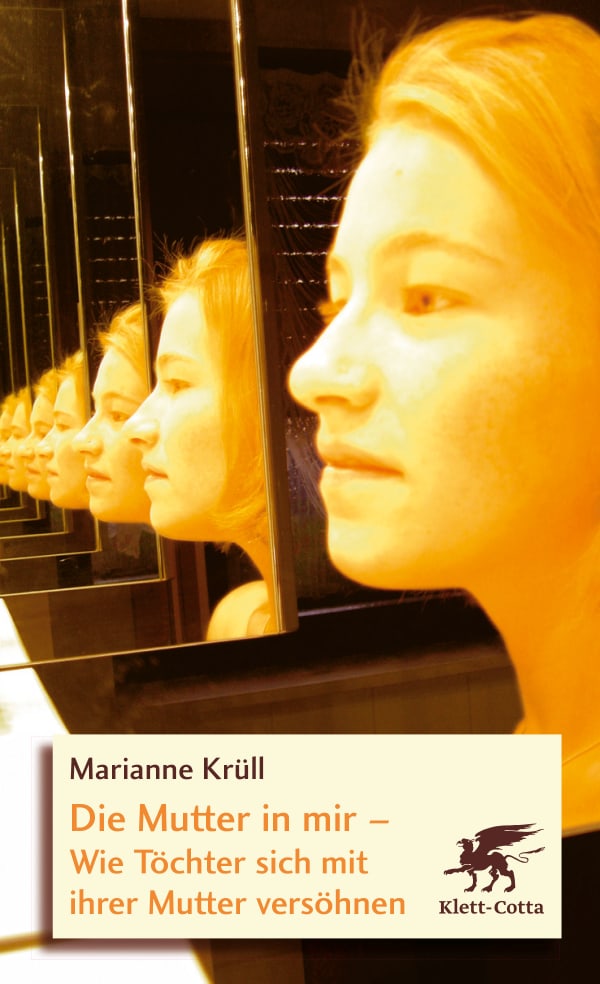Die Mutter in mir
Wie Töchter sich mit ihrer Mutter versöhnen
Beschreibung
Wie Töchter sich mit ihrer Mutter versöhnen
Mutter-Tochter-Beziehungen sind häufig problematisch. Oft fühlen sich Töchter entweder überbehütet und nie losgelassen oder vernachlässigt und abgewertet. So wie ihre Mutter wollen sie jedenfalls nicht werden. Marianne Krüll läßt Töchter die Lebensgeschichte ihrer eigenen Mutter in der Ichform erzählen und zeigt, wie sie dadurch zu einem neuen und besseren Verständnis ihrer gemeinsamen Beziehung gelangen können.
Enttäuschung, Trauer, Wut, manchmal sogar Hass - das sind einige der heftigen Emotionen, die viele Töchter ihrer eigenen Mutter entgegenbringen. »Warum hat sie mich nicht geliebt?« oder »Warum hat sie mich völlig vereinnahmt und damit missbraucht?«, solche Fragen stehen häufig als Anklage im Raum; die Töchter bleiben mit ihren negativen Gefühlen allein. Wie aber kann es zu einer Versöhnung mit der Mutter kommen?
In 24 Geschichten erzählen Töchter mit ihren eigenen Worten in der Ichform die Lebensgeschichte ihrer Mutter. Durch diesen Perspektivwechsel gelingt es ihnen, ihre Mutter in einem völlig neuen Licht zu betrachten. Der Konflikt, die Vorwürfe, die unverstandenen Gefühle - all das löst sich auf in einem befreienden Verständnis. Es gelingt, die eigene Mutter sozusagen von innen zu erspüren - eben als die »Mutter in mir« - und sich mit ihr zu versöhnen.
»Fast immer wünschen wir uns eine andere, bessere Mutter gehabt zu haben, eine, die uns das gegeben hätte, was wir glauben, gebraucht zu haben. Mit meinem Buch will ich einen Weg aufzeigen, wie wir als Töchter mit unseren Müttern zu einer Versöhnung kommen können, so dass die Liebe wieder fließen kann und wir Formen der Abgrenzung zwischen uns finden, die nicht Ausgrenzung sind.«
Bestseller-Autorin Marianne Krüll
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Marianne Krüll
Dr. Marianne Krüll ist Mutter von zwei Töchtern und Großmutter, engagierte Feministin, Schriftstellerin, Soziologin. Sie war Akademische Rätin am S...
Dr. Marianne Krüll ist Mutter von zwei Töchtern und Großmutter, engagierte Feministin, Schriftstellerin, Soziologin. Sie war Akademische Rätin am Seminar für Soziologie der Universität Bonn, wo sie heute lebt. Zahlreiche Buchpublikationen, darunter: »Käthe, meine Mutter«, »Im Netz der Zauberer - Eine andere Geschichte der Familie Mann«, »Freud und sein Vater«, »Schizophrenie und Gesellschaft«.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die »Mutter in mir«
Wie die Geschichten entstanden sind
Mütter der Jahrgänge vor 1920
Mütter der Kriegsjahre
1 Hedwig (1914-2001) und Christa (1944)
Die Mutter mußte alles aushalten und war in all ihrer Traurigkeit doch irgendwie auch glücklich
2 Gerda (1918) und Antje (1942)
Der Sohn war und ist der Liebling der Mutter
3 Elfriede (1913-1992) und Edeltraud (1939)
Der frühe Tod von Elfriedes Eltern als Schatten über ihrem Leben - Mutter und Tochter machen etwas daraus
4 Mathilde (1911-1987) und Rosa (1954)
Die Tochter als ungeplanter Nachkömmling der alten Mutter
5 Antonia (1895-1923) und Ingeborg (1923)
Die Mutter starb bei der Geburt der Tochter
6 Gertrude (1909-1980) und Maria (1940)
Die Mutter liebt den Sohn über alles, die Tochter ist nur »Ersatz« für eine verstorbene Tochter
7 Lina (1910-2001) und Inge (1948)
Die Mutter ist auf Männer fixiert, die Tochter begehrt auf und schafft es allein
Mütter der Jahrgänge zwischen 1921 und 1930
Mütter der Nachkriegsjahre
8 Hildegard (1928-1982) und Christine (1948)
Das Geheimnis der Eltern, das nach drei Generationen allmählich gelüftet wird
9 Ingrid (1929) und Marika (1957)
Die Tochter kam angeblich ins Waisenhaus
10 Mia (1925) und Angelika (1952)
Die Mutter lebt nach dem Krieg in einer »Frauen-Enklave« - die Tochter befreit sich schrittweise immer mehr
11 Ilse (1926) und Jutta (1953)
Die Tochter tritt in Mutters Fußstapfen in starker Verbundenheit und Frauensolidarität
12 Babett (1922) und Dorothea (1955)
Die Mutter hält fünfzig Jahre bei einem ungeliebten Mann aus, die Tochter weint noch immer mit ihr
13 Petronella (1930) und Gudrun (1954)
Mutter und Tochter sind krebskrank
Mütter der Jahrgänge nach 1931
Mütter der Wohlstandsjahre
14 Gisela (1936) und Inga (1961)
Die emanzipierte Mutter und die lesbische Tochter
15 Ulla (1938-2002) und Beate (1978)
Die Mutter nimmt ein Geheimnis mit ins Grab
16 Carla (1938-1992) und Judith 1965)
Der unerfüllte Kinderwunsch der Tochter und die von der Mutter übernommene Traurigkeit
17 Elisabeth (1934) und Anke (1960)
Die Tochter, ein Einzelkind, spielt mit dem Vater das »Mutter-ärgern-Spiel«
18 Irmgard (1939) und Michaela (1968)
Die ohne Vater aufgewachsene Mutter wollte ein Kind, nicht aber den Mann
19 Annegret (1952) und Marlies (1970)
Ein Kind wird Mutter, und die Tochter macht was daraus
20 Annette (1946) und Jana (1964)
Die haltlose Mutter hat ihre Kinder »ausgesetzt«, die Tochter sucht ein positives Mutterbild, um selbst gute Mutter sein zu können
Zwei Mutter-Tochter-Paare:
Ulrike - Sarah und Ursula - Grit
21 Ulrike (1947) und Sarah (1976)
Die Tochter mit zwei Müttern in einer lesbischen Lebensgemeinschaft der Mutter
22 Charlotte (1917) und Ulrike (1947)
Die Stärke der Frauen in den beiden Weltkriegen, die ihren Töchtern - und der Enkelin! - den Weg bereiten
23 Ursula (1940) und Grit (1967)
Tochter Grit und Mutter Ursula nehmen gemeinsam am Mütter-Töchter-Seminar teil - die Tochter erlebt ihre Mutter und Großmutter neu
24 Frieda (1908-1977) und Ursula (1940)
Die Mutter (mit beinamputiertem Mann) war »jeden Tag am Ende ihrer Kräfte«, die Tochter erstarkt daran
Neue Wege zur Versöhnung
Die Erzählung der Muttergeschichte in der Ichform - ein vergleichender Überblick
Prägende Erlebnisse in den Kriegsjahren
Generationenfolge von Müttern und Töchtern
Ungewollte Schwangerschaften
Sexualität - das große Tabu
Männer im Leben der Frauen
Das »verpaßte« Leben
Der Blick aufs Ganze - die Mythen von der »perfekten« Mutter und dem »starken« Mann
Der Muttermythos - eine gefährliche Falle
Die männerzentrierte Gesellschaft und der Mythos vom »starken« Mann
Folgen des Männlichkeitsmythos
Solidarität unter Frauen
Ausblick - für Töchter und Mütter
Was wir als Töchter tun können
Die Rolle der Väter
Was wir als Mütter tun können
Die Mutter als geistig-spirituelles Prinzip
Dank
Literatur
Das könnte Sie auch interessieren:

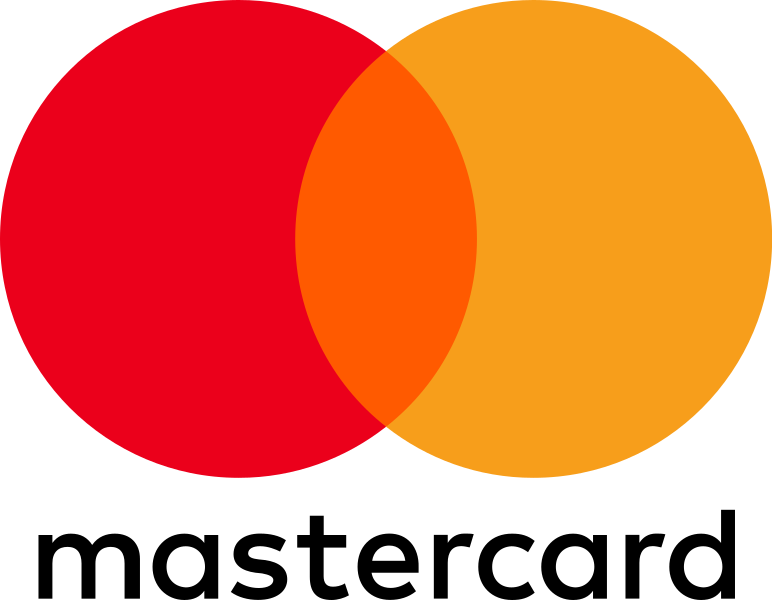

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt