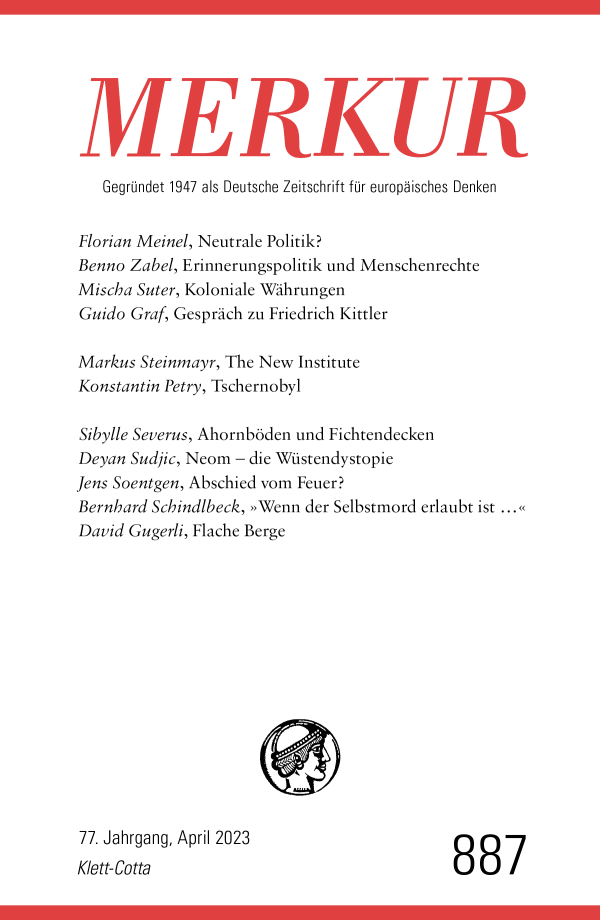MERKUR 4/2023
Nr. 887, Heft 4, April 2023
Beschreibung
Claudia Gatzka analysiert die Mängel der gängigen Rechtsextremismus-Theorie. Die Dichterin Monika Rinck sieht sich mit Gedichten eines Bots konfrontiert, der ihr eigenes Werk auf manchmal durchaus unheimliche Art imitiert. Moritz Rudolph rät, es angesichts der Krisen der Gegenwart mit einer Politik der Freundschaft zu versuchen.
Das Heft gibt es auch günstig im >> MERKUR-Probeabo - auch >> Probeabo, online
Im Aufmacher fragt Claudia Gatzka, ob die Rechtsextremismus-Theorie, die Nationalismus am Rand der Gesellschaft verortet, nicht der Einsicht im Weg steht, dass er in deren Mitte ebenso existiert.
Die Dichterin Monika Rinck sieht sich mit Gedichten eines Bots konfrontiert, der ihr eigenes Werk auf manchmal durchaus unheimliche Art imitiert.
Carl Schmitts Theorie des Politischen mit ihrer Fixierung auf Feindschaft ist gerade wieder en vogue – Moritz Rudolph skizziert einen Gegenentwurf der politischen Freundschaft.
In seinem neuen Buch “Der arbeitende Souverän” nimmt Axel Honneth das Verhältnis von Zusammenhängen der Arbeit und demokratischer Willensbildung in den Blick – und erklärt dabei auch, warum das bedingungslose Grundeinkommen keine Lösung für die existierenden Probleme ist.
Fara Dabhoiwala hat die Autobiografie des indischen Wirtschaftsintellektuellen Amartya Sen gelesen. Für Bernhard Dotzlers Geschmack macht Geert Lovink in seinem neuesten Internet-Plattform-kritischen Buch zu viele halbe Sachen. Über die Diskussionen, die Russlands Krieg gegen die Ukraine bei den Vertreterinnen und Vertretern der Osteuropageschichte ausgelöst hat, informiert Andreas Hilger.
Werner Krauß beobachtet Auswirkungen des Klimawandels vor Ort, nämlich in einem norddeutschen Dorf namens Büppel. Georg Vobruba skizziert die wesentlichen Züge des Verschwörungsdenkens. In David Gugerlis Schlusskolumne geht es um das, was verschwinden soll, aber nicht will.
Bibliographische Angaben
Autor:innen
Christian Demand(Hrsg.)
Christian Demand, Jg. 1960, hat Philosophie und Politikwissenschaft studiert und die Deutsche Journalistenschule absolviert. Er war als Musiker und...
Christian Demand, Jg. 1960, hat Philosophie und Politikwissenschaft studiert und die Deutsche Journalistenschule absolviert. Er war als Musiker und Komponist tätig, später als Hörfunkjournalist beim Bayerischen Rundfunk. Nach Promotion und Habilitation in Philosophie unterrichtete er als Gastprofessor für philosophische Ästhetik an der Universität für angewandte Kunst Wien. 2006 wurde er auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg berufen, wo er bis 201...
Ekkehard Knörer(Hrsg.)
Hefte der gleichen Zeitschrift
Alle Hefte der Zeitschrift
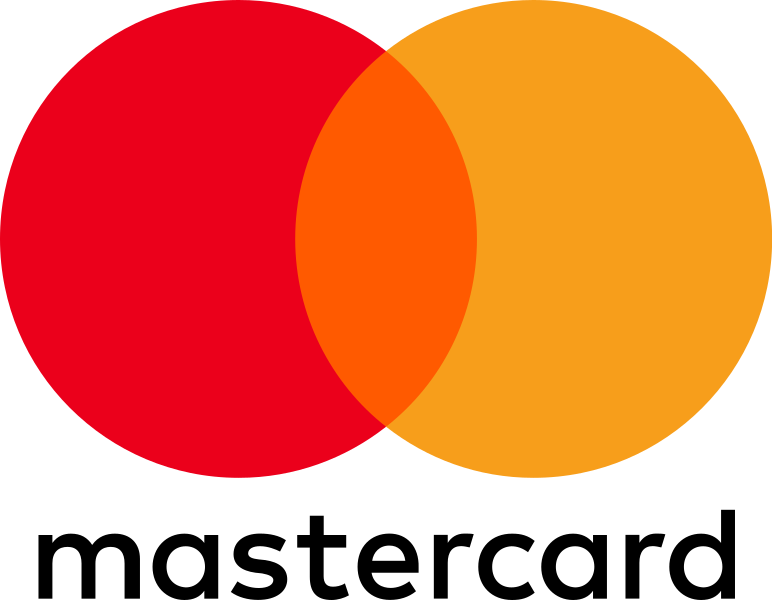

Bestell-Informationen
Service / Kontakt
Kontakt